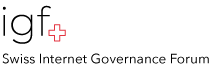Programm Swiss IGF 2022, hybrid
Programm als PDF (Stand 31.5.2022)
Die Sessions werden auf der Swiss IGF-Webseite am Konferenztag unter www.igf.swiss/live übertragen.
Tagungsleitung und Gesamtmoderation: Jacques Beglinger (Beglinger LPC) und Livia Walpen (BAKOM International Relations), Swiss IGF Co-Sekretariat
08:30-09:00
Registrierung (Welle 7, Bern) beziehungsweise Login
09:00-09:15
Eröffnung
Mit Bernard Maissen, Direktor Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
09:15-10:45
Plenum 1: «Regulierung» von Künstlicher Intelligenz – Was macht die Schweiz?
Das Plenum bespricht den Regulierungsbedarf und die Regulierungsoptionen für Künstliche Intelligenz (KI) in der Schweiz. Die Europäische Union hat mit dem Vorschlag für eine Verordnung zu KI (AU AI Act) bereits vorgelegt. Vor dem Hintergrund der technischen und rechtlichen Entwicklung stellt sich die Frage, ob auch in der Schweiz Handlungsbedarf besteht. In den letzten Monaten wurden einige – teils unterschiedliche – Regulierungsansätze präsentiert. Drei davon werden im Rahmen von Input-Referaten vorgestellt. Diese und weitere Ansätze werden zusammen mit Expert:innen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft diskutiert.
Input: Roger Dubach (EDA), Stephanie Volz (ITSL, Universität Zürich), David Sommer (Digitale Gesellschaft)Moderation: Nadja Braun Binder, Florent Thouvenin➥ Weitere Informationen zum Plenum 1
10:45-11:00
Pause
11:00-12:30
Plenum 2: Plattformen: Politische/wirtschaftliche Herausforderungen und Regulierung
Digitale Plattformen zeigen sich in immer mehr Bereichen als bevorzugtes Geschäftsmodell. Ergibt sich, z.B. aufgrund von Netzwerkeffekten, eine dominierende Positionierung, stellen sich rasch Fragen zu negativen Auswirkungen, von Marktverzerrung hin zur Frage der Verantwortung der Plattformen und ihrer Rolle in der Meinungsbildung. Global und insbesondere auf europäischer Stufe wird Plattformregulierung heiss diskutiert. Was bedeuten die europäischen Regulierungsvorhaben Digital Services Act und Digital Markets Act für die hiesige Medien- und Wettbewerbspolitik und welcher Handlungsbedarf und Spielraum ergeben sich daraus für die Schweiz?
Input: Angela Müller (AlgorithmWatch Schweiz), Franziska Oehmer-Pedrazzi (Fachhochschule Graubünden), Maximilian Schubert (Facebook)
Moderation: Thomas Häussler (Bakom), Riccardo Ramacci (Stiftung Mercator Schweiz)
Koordination: Nicolas Zahn (Swiss Digital Initiative), Riccardo Ramacci (Stiftung Mercator Schweiz), Philippe Rocheray (Seco), Thomas Häussler (Bakom)
12:30-14:00
Mittagessen / Mittagspause
Lunch in Welle 7
13:00-13:45
Mittagsdiskussion: Governance des Swiss IGF als Multistakeholder-Format
Offene Diskussion über die Rollen und Aufgaben im Schweizer IGF-Prozess, über die wesentlichen Merkmale der IGF-Sessionen, über die Positionierung des Swiss IGF innerhalb des UN IGF-Prozesses und über die Sicherung des Multistakeholder-Ansatzes.
Input und Moderation:: Jacques Beglinger + Livia Walpen (Swiss IGF Co-Sekretariat)
Parallele Workshops
14:00-15:30
Workshop 1: Digitalisierung und Nachhaltigkeit – Chancen und Risiken
Der steigende Energiebedarf, der für die digitale Gesellschaft und Wirtschaft benötigt wird, ist eine der grossen Herausforderungen im Streben nach mehr Nachhaltigkeit. Gemäss Schätzungen hat der IKT-Sektor 2020 bis zu 7 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs ausgemacht, Tendenz steigend. Insbesondere auch die Ausbreitung digitaler Währungen beschleunigt den Energieverbrauch. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung Chancen im Hinblick auf Effizienzgewinne, durch die Emissionen teilweise ausgeglichen werden können – es fragt sich allerdings, ob diese Effekte angesichts des Klimawandels hinreichend sind.
Input: Matthias Galus (Bundesamt für Energie), Julie Chenadec (Sustainable Digital Infrastructure Alliance), Fabienne Biedermann (Solafrica)
Moderation: Flurina Wäspi
Koordination: Flurina Wäspi (Berner Fachhochschule), Philippe Lionnet (Seco), Fabio Monnet (Fabio Monnet)14:00-15:30
Workshop 2: Cybersicherheit und Cyberkompetenz
Da die Welt immer stärker vernetzt ist, werden die Reichweite und die Handlungsmöglichkeiten möglicher Cyber-Angreifer immer größer. Darüber hinaus stellen die zunehmende Komplexität, Schwachstellen oder Unvorhersehbarkeit unserer gesamten IKT-Struktur selbst eine Bedrohung dar. Gleichzeitig wird das für den Umgang mit der Cybersicherheit erforderliche Know-how immer schwieriger und für die meisten Menschen unzugänglicher. Wie können wir unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyber-Bedrohungen verbessern? Wie gehen wir mit solchen Risiken um? Wer oder was fängt beim derzeitigen Stand der Dinge den Schaden auf, und wie wirkt sich dies auf unsere künftigen Herausforderungen aus?
Input: Pierre Maudet (WISeKey), Daniel Caduff (BWL), Levente Dobszay (InfoGuard), Yuliya Morenets (TaC – Together against Cybercrime), Dario Haux (Universität Basel)
Moderation: Nicolas Zahn (Swiss Digital Initiative)Koordination: Daniel Caduff (BWL), Levente Dobszay (InfoGuard)
14:00-15:30
Workshop 3: Digitale Partizipation
Die Bereitstellung von digitalen Partizipationsinstrumenten wird für die öffentliche Hand im Zuge der digitalen Transformation unumgänglich. Digitale Partizipation verspricht als Ergänzung zur analogen Partizipation unter anderem mehr Austausch zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern, mehr Vertrauen in politische Prozesse und eine Raumentwicklung, die am Puls der Gesellschaft ist. Aber wie gelingt es, dass die digitale Partizipation nicht zu einem weiteren Gefäss der Immer-Partizipierenden wird? Welche digitalen Kompetenzen müssen vorausgesetzt werden? Und wie kann digitale Partizipation möglichst inklusiv sein? ? Neben diesen Fragen werden wir auch das Projekt „Data Literacy Journey“ diskutieren, das derzeit von Opendata.ch durchgeführt wird, und eine Ressource erstellen will, welche die vielen Facetten der Datenkompetenz auf zugängliche, klare und unterhaltsame Weise abbildet.
Input: Julie Erard (Projektleiterin Budget participatif, Stadt Lausanne), Martina Jäggi und Thomas Werner (Bibliothek 4.0 Winterthur, Bibliotheken Winterthur), Nikki Böhler (Geschäftsführerin Opendata.ch)
Moderation: Jasmin Odermatt, Amélie Vallotton Preisig
Koordination: Flurina Wäspi (Berner Fachhochschule), Jasmin Odermatt (Stadt Aarau), Amélie Vallotton Preisig (BIBLIOSUISSE, Universität Bern)
15:30-15:45
Pause
15:45-17:15
Plenum 3: Datenbasierte Gesellschaft und politische Souveränität
Um bedürfnisgerechtere und effizientere Leistungen in wichtigen Bereichen wie Gesundheit, Mobilität, Energie, Bildung, Finanzen etc. zu ermöglichen, soll auch in der Schweiz das Potenzial von Daten und ihrer Nutzung besser ausgeschöpft werden. Gleichzeitig schürt die fortschreitende Plattformisierung und Datennutzung Ängste bei Individuen und Firmen, die Kontrolle über ihre eigenen Daten zu verlieren. Auf allen Kontinenten einschliesslich Europa wird über Fragen der «digitalen Souveränität» diskutiert. Am 30. März 2022 hat der Bundesrat Massnahmen zur Förderung vertrauenswürdiger Datenräume und der «digitalen Selbstbestimmung» beschlossen. Wie können wir das Datenpotential besser nutzen, welche Hürden sind dabei zu bewältigen und wie können wir unsere «digitale Souveränität» und «digitale Selbstbestimmung» stärken?
Input: Christian Laux (Laux Lawyers AG, Zürich/Basel), Lennig Pedron (Trust Valley, Genève), Urs Leimbacher (Head Public Affairs, Swiss Re), Markus Tiede (CH-Open)
Moderation: Thomas Schneider (Bakom), Philippe Lionnet (Seco)
Koordination: Anja Wüst (Berner Fachhochschule), Philippe Lionnet (Seco), Thomas Schneider (Bakom)
17:15-17:30
Wrap-up & und Verabschiedung der «Messages from Berne»
Die «Messages von Bern» fassen die Hauptpunkte der Sessions am Swiss IGF 2021 kurz, prägnant und neutral zusammen. Sie werden anschliessend dem globalen UN Internet Governance Forum (IGF) und dem «European Dialogue on Internet Governance» (EuroDIG) vorgelegt, um in die Diskussionen in diesen Foren einzufliessen.
17:30
Ende der Konferenz